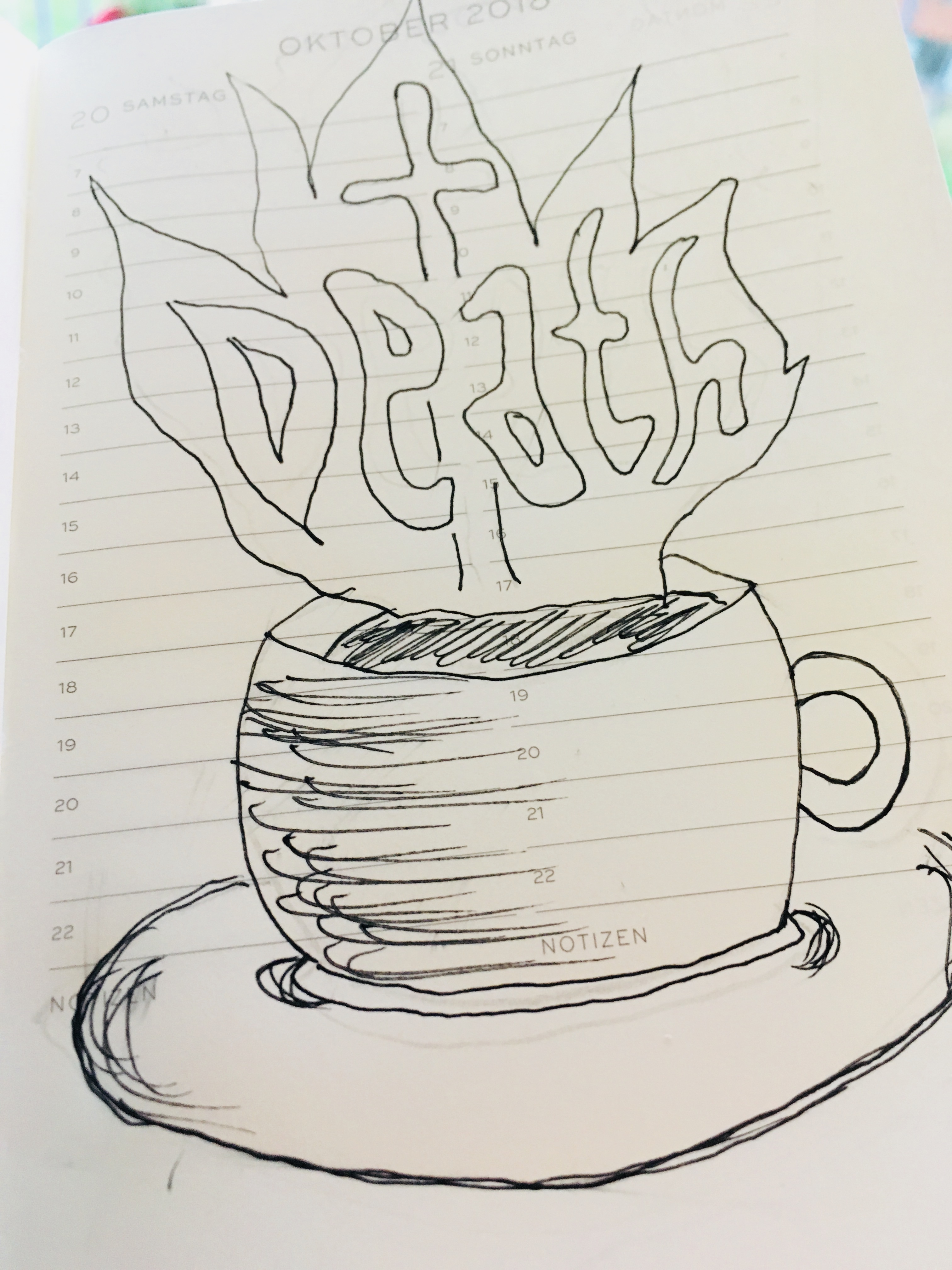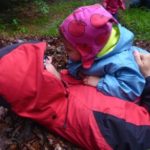Gestern fand bei uns im Haus bzw. unten im Salon am Park das erste Death Cafe statt. Diese Death Cafes gibt es weltweit. Sie sind eine non-profit Initiative, damit Menschen sich treffen können um ohne Anlass offen über das große und oftmals schwere Thema Tod zu reden. Und weil mich das Thema privat sehr beschäftigt und mein Leben lang schon begleitet, habe ich mich aufgemacht, um so ein Death Cafe kennenzulernen.
Wir waren eine für mich recht große Runde. Ca. 15 Frauen und Männer, von denen ich einige persönlich kannte, einige flüchtig und andere gar nicht. Das macht natürlich was aus. Rede ich mit Fremden über den Tod, wenn da vielleicht Emotionen hochkommen? Oder ist es mit ihnen vielleicht sogar einfacher als mit Bekannten und Freunden? Ich ließ mich auf all das ein und fand es äußerst inspirierend und spannend. Es war traurig und tröstend zugleich.
Traurig war für mich das Thema, als es um das Abschiednehmen ging. Das war für mich ja nicht möglich damals, als mein Bruder starb. Ein Autounfall kann eben so ein Leben radikal beenden. Als mein Vater damals fragte, ob wir mitkommen würden, um uns meinen aufgebahrten Bruder noch einmal anzusehen, war ich schockiert. Allein die Vorstellung jagte mir Angst und Schrecken ein. Warum würde man das wollen? Und wie würde man so etwas überhaupt emotional schaffen? Bleibt das Bild nicht ewig im Kopf hängen? Später habe ich mit meinem Vater mal darüber geredet und verstanden. Er ist damit aufgewachsen, bei ihm war es üblich, wie bei so vielen anderen ländlichen Kulturen auch, dass die Toten zum Verabschieden noch einmal aufgebahrt werden. Diese Tradition geht mehr und mehr verloren. Die Krankenhäuser bieten das gar nicht alle an. Stirbt jemand daheim und man ruft den Notarzt, geht alles seine geregelten Wege, der Tote wird schneller abtransportiert, als den Menschen manchmal lieb ist und man kann, ja darf es teilweise sogar nicht verhindern. Andererseits scheuen sich viele – so wie ich auch damals – davor, einen Toten zu sehen. Da ist Angst. Angst vor den eigenen Emotionen. Angst vor dem Anblick. Angst davor, dass es grausam, gruselig oder einfach unfassbar traurig sein würde. Doch je mehr wir im Death Cafe über dieses Abschiednehmen gesprochen haben, umso trauriger wurde ich. Weil die Geschichten, die andere erzählt haben vom Abschied, so tröstlich und teilweise schön waren. Und weil ich diese Möglichkeit nie hatte. Deshalb versuche ich scheinbar seit Jahren durch das Schreiben in meinen Geschichten Abschied zu nehmen. Stück für Stück. Heilsam, aber eben auch schmerzhaft.
Tröstend waren auch die Geschichten von Sterbenden, die der Tatsache, dass sie im Sterben liegen, ins Auge geblickt haben. Die akzeptiert haben, dass er unausweichlich kommen wird, der Tod. Die weniger ängstlich, eher leise und leicht in den Tod gegangen sind. Und dass es nicht immer das unfassbar grausame Ende sein muss, das für uns Menschen so ungreifbar scheint. Und so angsteinflößend.
Es hat mir wieder einmal gezeigt, dass es auch wichtig ist, mit Kindern offen diesem Thema gegenüber zu sein. Und vielleicht kann das für uns auch wertvoll sein, uns selbst dem etwas mehr zu nähern. Als ich mit 14 zum ersten Mal in meinem Leben auf dem Begräbnis meines Bruders war, hatte ich keine Ahnung was auf mich zukommen würde. und ich war allein. Alle waren so sehr mit sich selbst beschäftigt, dass ich nicht nur schockiert, sondern auch verunsichert war. Der Sarg erschlug mich mit seiner Wucht, wie er da groß, gewaltig und hölzern stand. Nie zuvor hatte ich so etwas gesehen. Und darin sollte er liegen. Das Loch in der Erde war tief. und was tat man nun? Was taten die anderen? Die Rose da rein, eine Handvoll Sand hinterher und Erde. Es ist sicher nicht das Ziel, Kinder so früh wie möglich mit auf eine Beerdigung zu nehmen, aber wenn man es tut, sollte man schon vorher viel mit ihnen darüber reden, sie darauf vorbereiten. Auf die vielen Tränen der Menschen dort, auf all die Dinge, die gesagt werden, den Ablauf. und wenn uns die Kinder über den Tod ausfragen, sollten wir das Thema nicht verdrängen, sondern offen sein. Offen für die Fragen und offen für die Antworten, die in uns auftauchen. Oder die wir gemeinsam suchen können.
Bei einem meiner letzten Besuche am Grab meines Bruders waren die Kinder mit dabei und haben mir Fragen gestellt. Das war sehr tröstlich und ein schöner Moment an einem traurigen Ort.
Unlängst fragte Herr Klein mich abends: „Mama, woran merkt man, dass man Krebs hat?“ Die Fragen der Kinder sind oft groß und weit. Aber ich glaube, dass sie uns selbst helfen können, auch für uns ein paar Antworten zu finden. Und auch den schweren Themen gut und weniger bedrohlich begegnen zu können.