Am Montag erzählte mir Herr Klein am Heimweg vom Kindergarten, dass der D. ihn beim Polizeipuzzle nicht mitmachen ließ. „Der hat gesagt: Nein! Du nicht!“ Ich sagte darauf: „Warst Du traurig?“. Stummes Nicken. „Du wolltest gern mitmachen beim Puzzle.“ Stummes Nicken.
Oft sind wir geneigt, zu trösten. Sätze wie „Na vielleicht kannst Du morgen wieder mitmachen.“, „Wenn der D. fertig ist, kannst Du ja damit spielen.“ oder „Habt Ihr nicht noch andere Puzzle, die Du machen kannst?“ kommen in uns hoch und wir hoffen, damit unser trauriges Kind wieder aufzuheitern beziehungsweise ihm vorzuschlagen, wie es mit der Situation umgehen kann. Das ist normal. Wir sind Eltern und wünschen uns nichts als glückliche Kinder. Oder wir versuchen den D. zu verteidigen, damit unser Kind „versteht“. Schließlich muss es ja Sozialisierung lernen. So wollen wir in einer solchen Situation ganz viel und schlagen dabei ganz viele Türen zu, die uns gemeinsam neue große Erfahrungsschätze hätten zeigen können.
Denn es sind weder Trost und Rat, den unsere Kinder wirklich brauchen. Vielmehr ist es das Gehört- und Gesehen werden. Das Artikulieren von den Gefühlen, die sie in sich tragen. Damit sie für sich selbst diese Worte lernen. Um sich selbst einmal entsprechend äußern zu können. Um ihre Gefühle kennenzulernen und lernen sie einzuordnen. Um dann Strategien zu entwickeln, wie sie selbst damit umgehen können.
Adele Faber und Elaine Mazlish schreiben in ihrem Buch „So sag ich’s meinem Kind“ folgendes: „Doch es ist ganz wichtig, dass wir unseren Kindern ein Vokabular für ihre innere Wirklichkeit geben. Sobald ihnen Worte für ihre Erfahrungen zur Verfügung stehen, können sie anfangen, sich selbst zu helfen.“
Muss ein Kind wirklich immer lernen, lernen, lernen?
Zugegeben, es klingt viel nach Lernen und wenig nach Beziehung. Letztendlich ist es aber beides gleichzeitig. Denn wenn ich, anstatt mein Kind sofort zu trösten oder Lösungsvorschläge zu bieten, einmal genau betrachte, ihm zuhöre, dann ausspreche, was ich sehe oder höre, trete ich mit meinem Kind in Beziehung. Ich erfahre etwas über mein Kind und zeige ihm: „Ich bin da. Ich höre Dich. Ich verstehe Dich.“ Und das ist für beide Seiten viel mehr wert. Es ist indirektes Lernen, wir fragen unser Kind ja nicht aus. Im Gegenteil. Oft führt es dazu, dass Kinder weiter erzählen. Und im Erzählen für sich selbst Lösungen finden. Und das wir in diesem Erzählen erfahren: „Wie geht es meinem Kind? Was beschäftigt ihn? Was erlebt er?“ Wir bekommen ein Bild von dem, was wir doch so oft wissen wollen: Was unsere Kinder wirklich tun, was sie empfinden, was sie denken. Hier haben wir die Möglichkeit dazu.
Und wenn wir ehrlich sind – was wünschen wir uns, wenn wir traurig, enttäuscht oder wütend sind? Jemanden, der uns mit Ratschlägen zur Seite steht, oder jemanden, der uns versteht, der uns mit unseren Gefühlen ernst nimmt?
Darf ich mein Kind etwa nicht trösten?
Es ist nicht immer leicht nicht zu bewerten. Nicht zu trösten und nicht zu beraten. Um ehrlich zu sein glaube ich, dass das mit das Schwierigste Am Elternsein ist: mich in die Gefühlswelt des Kindes einzufühlen, sie zu verstehen versuchen und auf Kindesebene zu bleiben. Doch wenn wir das schaffen, wenn wir statt langen Erklärungen und Mitleidsbekundungen einfach da sind, zuhören und verstehen, dann schenken wir uns und unserem Kind echte Beziehung und innigen Kontakt, der wertvoller ist, als eine tröstende Umarmung. Denn dieser Kontakt bleibt und wächst. Eine Umarmung geht. Was nicht heißt, dass wir unserem Kind keinen Trost schenken sollen. Natürlich brauchen sie den genauso. Aber nicht ausschließlich. Und was klingt tröstender, ein „Oje, mein armer Schatz!“ oder ein „Oh, da wäre ich auch traurig gewesen.“ Wo fühle ich mich bemitleidet und klein, und wo gehört und verstanden?
Aber was wenn meine erste authentische Reaktion Trost und Umarmung ist?
Dann ist das so und es ist legitim. Aber es schadet nicht, sich mit der Thematik zu befassen und dennoch das Kind zu hören, seine Gefühle zu erkennen. Natürlich ist es ein Lernprozess, denn die wenigsten von uns sind so aufgewachsen und haben dieses Verständnis erfahren.
Neulich mussten wir zum HNO. Herr Klein hatte Angst, wie so oft. Er war sehr angespannt, das merkte ich. Ich versuchte ihn aufzuheitern, indem ich sagte: „Und wenn wir dann nach hause kommen, kannst Du noch ein bisschen mit M. & E. – unseren Nachbarskindern – spielen. Herr Klein sagte: „Aber nicht in mein Ohr pieksen!“ Er war noch ganz woanders. Er war mit seinen Gedanken und Gefühlen noch völlig bei dem bevorstehenden Arztbesuch. „Du hast Angst.“ Stummes Nicken. „Das ist unangenehm, wenn die Ärztin ins Ohr schaut und man nicht sieht, was sie tut.“ Stummes Nicken. Ich nahm Herrn Klein auf meinen Schoß und hielt ihn fest. „Das verstehe ich. Ich mag das auch nicht.“ sagte ich ihm leise. Er sagte nichts weiter, lehnte sich nur an mich.
Authentische Reaktionen sind immer die ehrlichsten, aber das bedeutet nicht, dass wir uns nicht ändern und unsere Ansichten verschieben können. Auch das ist Teil des Gemeinsamen Wachsens, von dem ich im Buntraum so oft rede. Wir müssen nicht auf körperliche Zuneigung und Trost und damit Authentizität verzichten, nur weil wir „richtig“ reagieren wollen. Es geht beides gleichzeitig.
Wir müssen als Eltern nicht perfekt sein. Das wollen unsere Kinder auch gar nicht. Sie wollen auch nicht immer nur glücklich sein. Sie wollen nur wissen, dass wir da sind für sie, wenn sie es mal nicht sind.





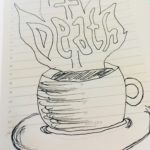
So ein schöner letzter Absatz. Danke!
Pingback: Hört euren Kindern zu! - Allerlei Themen Blog